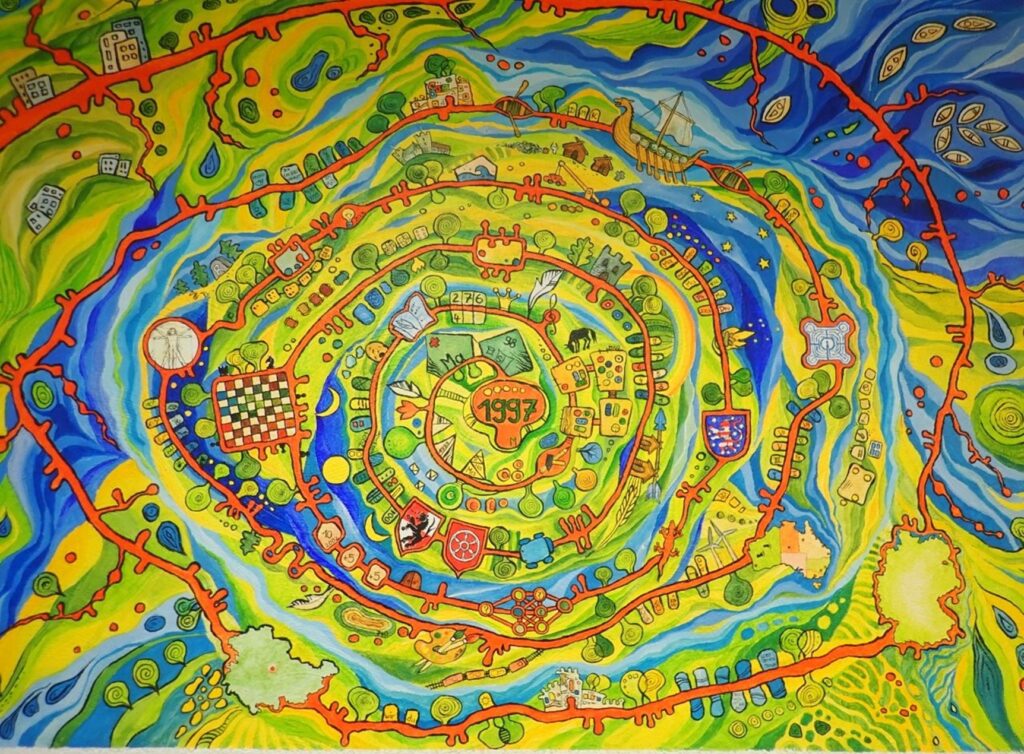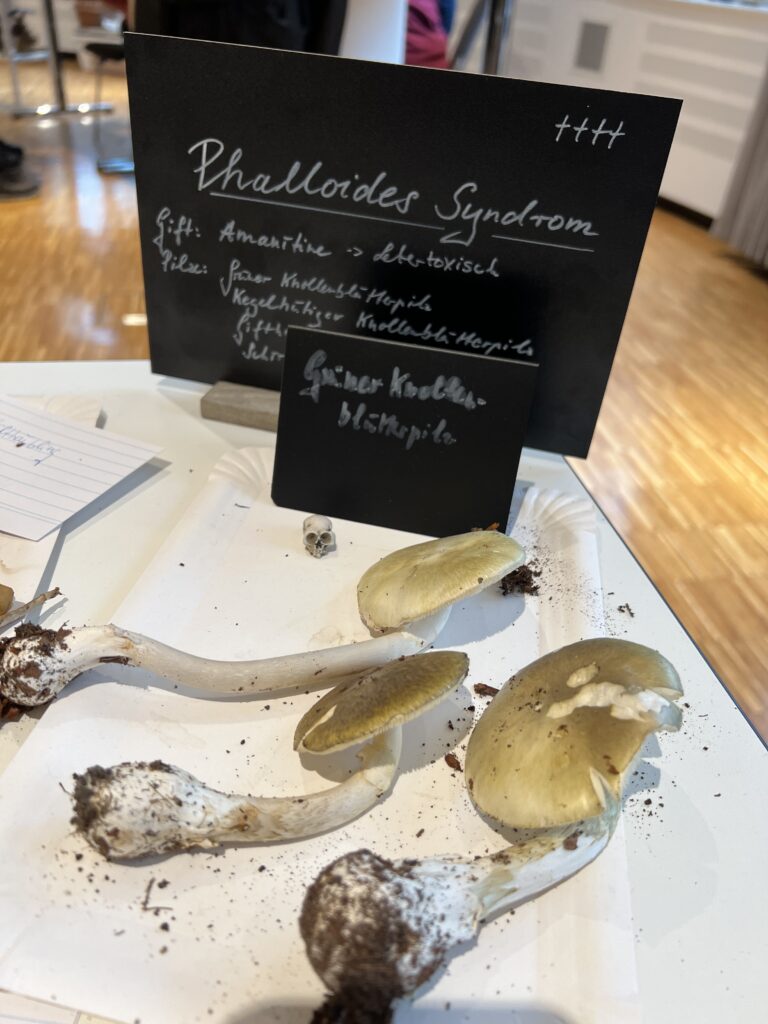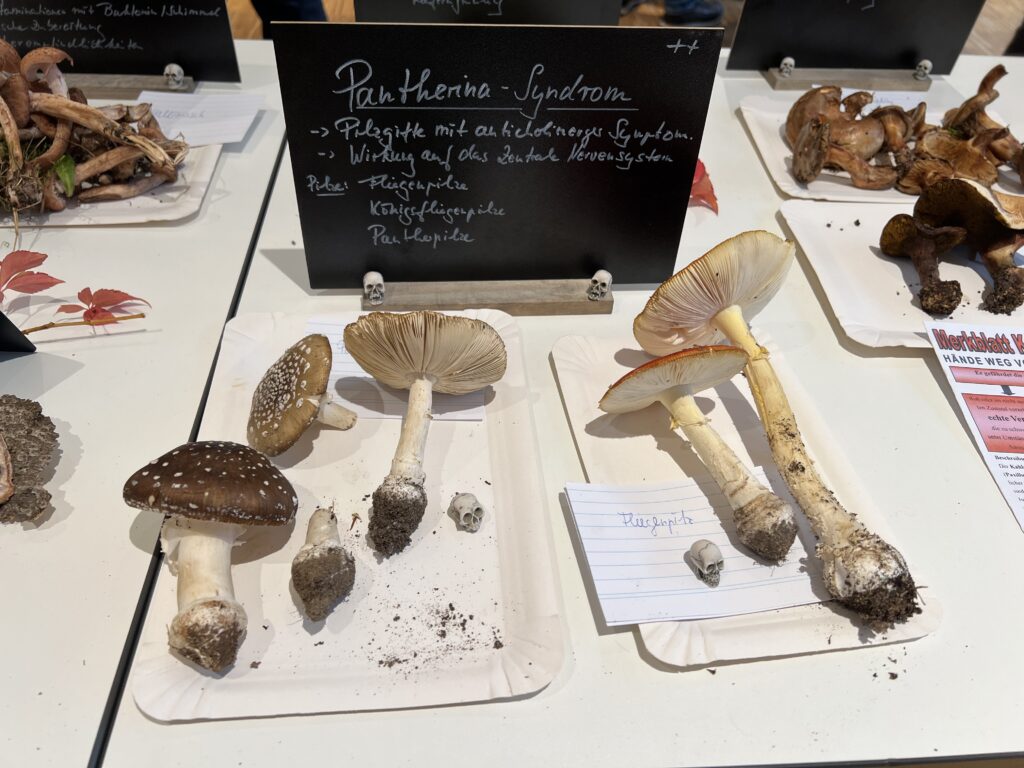Exkursionsbericht 6. Dezember 2025
Bericht: Jochen Girwert
MTB: 4933,41


Am 6. Dezember fand die letzte ThAM-Exkursion des Jahres bei Schloss und Park Ettersburg statt. Dieses Schloss gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe „Klassisches Weimar“. Es handelt sich um einen besonderen Ort, an dem man sich den großen Geistern der Weimarer Klassik verbunden fühlen kann und an dem auch heute noch kulturelles Leben stattfindet.
Es macht sich gut, wenn unsere Exkursionen an besonderen attraktiven Orten stattfinden, aber natürlich stehen für uns die Pilze im Mittelpunkt des Interesses.



Aus dem Park und dem umgebenden Wald sind Arten wie Anhängselröhrling, Ockersporiger Speisetäubling, Milder Kammtäubling und Rauchgraue Keule bekannt. Die Kenntnis der vorkommenden Arten ist allerdings lange nicht vollständig.

Gleich am Eingang zum Schlosspark fand sich der attraktive Kupferrote Lackporling an lebender Buche. Wiesenpilze im relativ mageren Parkrasen fanden sich leider nicht mehr.

Die Speisepilzesammler mussten sich mit wenigen Fruchtkörpern begnügen. Besondere Beachtung fanden Exemplare des Grauen Leistlings – Cantharellus cinereus, der auf den ersten Blick frappierend der Totentrompete ähnelt. Das düstere Aussehen täuscht – die Fruchtkörper duften wunderbar aromatisch.

Unsere Exkursion im Dezember war erneut sehr interessant. Man muss sich allerdings auch auf kleine und unauffällige Arten einlassen, die dann bei näherer Betrachtung doch ausgesprochen reizvoll sind. Es folgen einige Beispiele:

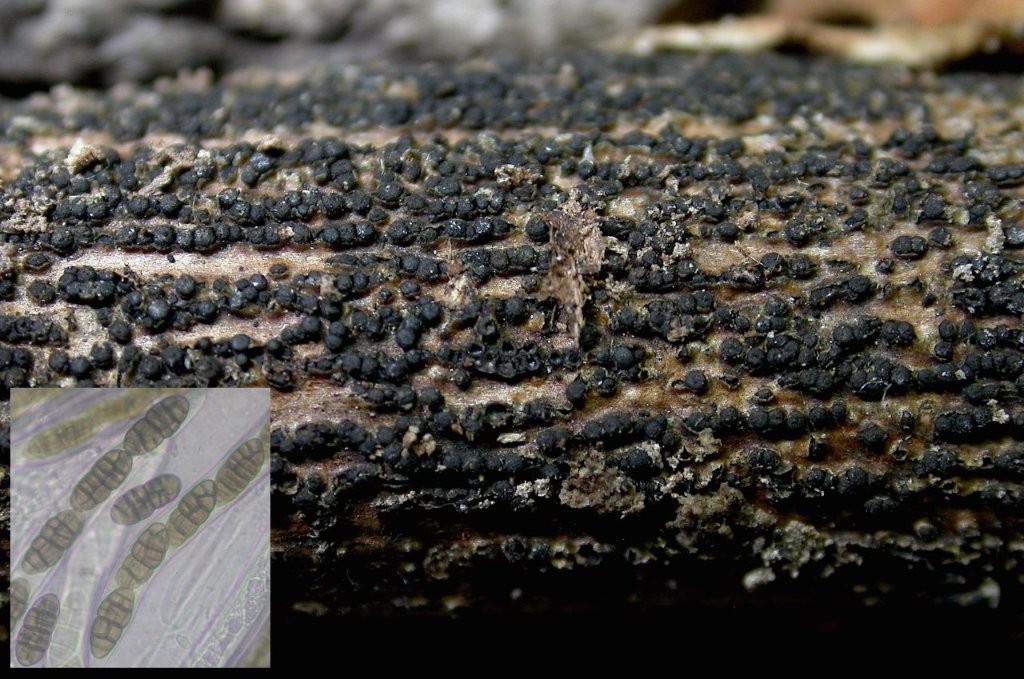



Ombrophila violacea – Violetter Gallertkreisling



Zur von Stefan Born durchgeführten Fundbesprechung wurde es sonnig und angenehm.

Fotos:
D. Wieschollek: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
F. Langguth: 1, 2, 5, 8, 17
J. Girwert: 3, 4, 6, 7